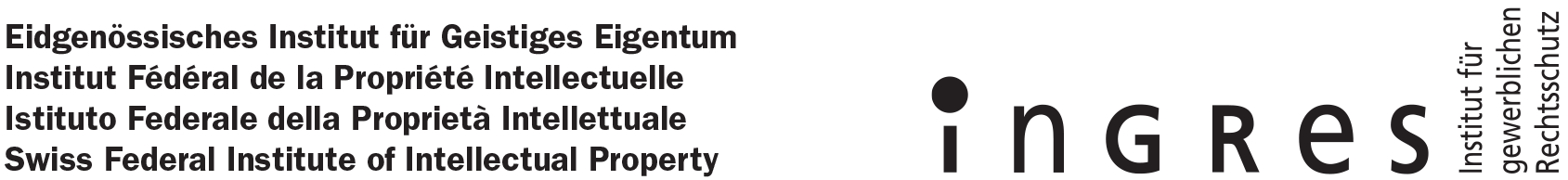
Ittinger Workshop vom 7./8. September 2012
Inhaltsverzeichnis
I.«Warm-up»
II.Jüngste Entwicklung der Design- und Markenpraxis aus der Sicht des HABM und des IGE
III.Aktuelle Rechtsprechung zum Design- und Markenrecht
IV.Designs und Marken aus unternehmerischer Sicht
V.Der Schutz des Designs im Zusammenspiel der Immaterialgüterrechte und des Lauterkeitsrechts: EU, Schweiz
VI.Workshops zu Schutzvoraussetzungen, Schutzumfang, relevante Betrachtungsweise sowie zur Inhaberschaft und Verwertung
VII.Erkenntnisse
Der von INGRES und dem IGE unter der Verantwortung von Dr. Christoph Gasser organisierte Ittinger Workshop vom 7./8. September 2012 in der Kartause Ittingen stand im Lichte des Verhältnisses zwischen Designrecht und Markenrecht, das sowohl aus der Sicht des schweizerischen als auch des europäisch harmonisierten und vereinheitlichten Rechts betrachtet wurde. Die provokante Titelthese des Workshops konnte nicht eindeutig beantwortet werden. Die angeregten Diskussionen zeigten jedoch deutlich, dass das Designrecht aus seinem Dornröschenschlaf erwacht ist und in der Praxis immer mehr eine eigenständige, vom Markenschutz unabhängige Bedeutung erlangt. Dies vor allem auch deshalb, weil Formmarken immer restriktiver gehandhabt und die Vorteile des Schutzes durch Designrecht zunehmend erkannt werden. Der Workshop zeigte darüber hinaus, dass im Designrecht zentrale Fragen noch ihrer Beantwortung harren.
Die Tagungsleiter Dr. Eric Meier, Leiter Marken des IGE, und Dr. Michael Ritscher, Präsident des INGRES, gingen nach kurzer Begrüssung gleich medias in res und forderten die Teilnehmer im Sinne eines Brain Storming dazu auf, sich Gedanken über Vorteile des Markenschutzes bzw. des Designschutzes zu machen.
Für den Markenschutz wurden u.a. folgende Vorteile angeführt:
-
– Schutzdauer
-
– Neuheit keine Voraussetzung
-
– Harmonisierung weltweit, Madrider-System
-
– Mehr Markenarten
-
– Rechtssicherheit im Streitfall (v. a. weil mehr Rechtsprechungspraxis besteht)
-
– Schutzumfang (Ausnahme: schwache Marken)
-
– Widerspruchsverfahren (und damit eine gewisse Rechtssicherheit betreffend die Rechtsbeständigkeit)
-
– Leichte Recherchierbarkeit und Überwachung
Für den Designschutz wurden u.a. folgende Vorteile erwähnt:
-
– Vermutung der Rechtsbeständigkeit
-
– Keine Gebrauchspflicht
-
– Einfachere Hinterlegung/Darstellung und Abbildung des Designs im Register unterliegt weniger starren Regeln
-
– Kein Spezialitätsprinzip (was sich auf den Schutzbereich auswirkt)
-
– Sammelhinterlegung
-
– Kein Widerspruchsverfahren (wobei sich hier die Teilnehmer nicht einig waren, ob dies zwingend ein Vorteil ist)
-
– Keine nationale Basiseintragung bei der internationalen Registrierung
-
– Keine designmässige Benutzung als Voraussetzung für Designrechtsverletzung
Stefan Fraefel vom IGE erörterte zunächst die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Verfahren zur Eintragung einer Marke bzw. eines Designs vor dem IGE. Grosse Unterschiede zwischen den beiden Immaterialgüterrechten ergeben sich insbesondere betreffend die Schutzdauer (beim Design maximal 25 Jahre), betreffend die Veröffentlichung auf Swissreg (beim Design erst nach erfolgter Eintragung; im Gesuchsstadium nur beschränkte Akteneinsicht), betreffend Internationale Registrierung (beim Design ist keine nationale Basisanmeldung notwendig) sowie betreffend Geltendmachung von Drittrechten (beim Design gibt es kein Widerspruchsverfahren).
Betreffend die Dauer des Eintragungsverfahrens ist das Designrecht im Allgemeinen metaphorisch tatsächlich auf der «Überholspur». Dies auch deshalb, weil es bei den Designanmeldungen weniger Probleme, d.h. weniger Beanstandungen gibt. Die meisten Designanmeldungen werden innerhalb von sechs Wochen eingetragen (internationale Registrierungen innert einer Woche geprüft). Bei offensichtlich unproblematischen Markeneintragungsgesuchen beträgt die Verfahrensdauer sechs Arbeitstage. Bei anderen Gesuchen kann es bis zu maximal 16 Wochen dauern; Expressgesuche werden innert einem Monat erledigt.
Eine Auswertung der Anzahl Marken- bzw. Designanmeldungen zeigt für die Schweiz eine parallel verlaufende Entwicklung, wobei die Anzahl Designanmeldungen um einiges geringer ist.
Der Prüfungsmassstab des IGE bei Marken- und Designanmeldungen ist bei der Prüfung des Verstosses gegen geltendes Recht, die guten Sitten und die öffentliche Ordnung gleich. Bei Designanmeldungen werden viele Beanstandungspunkte «informell» per Telefon erledigt, was sicherlich zur Verfahrensbeschleunigung beiträgt.
Gemäss Stefan Fraefel gibt es aus seiner Sicht einige offene Fragen, wobei sich bei Designanmeldungen weniger Probleme ergeben, weil beim IGE nur wenige Schutzausschlussgründe geprüft werden. Insbesondere bei der Anmeldung von Formmarken stellen sich Fragen betreffend die technische Notwendigkeit nach Art. 2 lit. b MSchG (Was gilt als alternative Form und wieviele solche Alternativen sind notwendig?), betreffend Formmarken, die evtl. das Wesen der Ware ausmachen (Die Praxis des BGer zur funktionalen oder ästhetischen Notwendigkeit bietet zu wenig Rechtssicherheit bzw. ist im Eintragungsverfahren nur schwer zu handhaben), sowie zuletzt betreffend Positionsmarken (Kann ein allein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen durch die Positionierung im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden? Muss es sich dabei um eine übliche oder um eine unübliche Positionierung handeln?).
Im Anschluss an die Ausführungen aus Sicht des IGE befasste sich Gregor Schneider mit der Eintragungspraxis des HABM (Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt). Um bei der Metaphorik «Designrecht auf der Überholspur» zu bleiben, meinte er, diese Frage könne je nach Gesichtswinkel metaphorisch auch anders gestellt werden («Zwei Strassen, die in verschiedene Richtung gehen und sich damit gar keinen direkten Wettbewerb liefern»). Der Unterschied zwischen der Anzahl Design- bzw. Markenanmeldungen ist in der EU nicht derart gross wie in der Schweiz. Auch in der EU ist dabei das Design betreffend Dauer des Eintragungsverfahrens deutlich auf der schnelleren Spur. Von der Anmeldung bis zur Eintragung dauert das Verfahren im Allgemeinen lediglich 10 Tage. Bei den Markenanmeldungen dauert das Verfahren in den häufigsten Fällen maximal 25 Tage. In den übrigen Fällen erfolgt die Markeneintragung im Allgemeinen innert maximal 10 Wochen.
Gregor Schneider zeigte danach anhand einzelner Schwerpunktthemen Unterschiede zwischen der Marken- und Designanmeldung auf. Betreffend technische Funktionalität spielen die Alternativen bei Formmarken keine Rolle; es genügt, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Das Amt vertrat gestützt auf die unterschiedliche Formulierung in den entsprechenden Vorschriften die Auffassung, dass beim Design das Niveau der Funktionalität höher sein müsse, d.h. der Ausschlussgrund nur greife, wenn das Merkmal für die Erreichung einer bestimmten technischen Wirkung unerlässlich sei. Dieser Unterschied in der Behandlung der technischen Funktionalität wurde jedoch in der Rechtspraxis wieder rückgängig gemacht, weil befürchtet wurde, das Patentrecht könnte durch das Designrecht umgangen werden. Aufgrund der weiteren Ausführungen zeigte sich, dass auch in der EU die Behandlung der ästhetischen Funktionalität viele Fragen offen lässt. So stellt sich gemäss Gregor Schneider die Frage, wer für die Bestimmung der ästhetischen Funktionalität massgebend ist: der Abnehmer und seine ästhetische Überzeugung oder der Werbewert. Bei der Bestimmung der Eigenart im Designrecht ist im Allgemeinen die Freiheit massgebend, die der Designer mit Blick auf die bestehende Designdichte hatte. Falls der Designer eine grosse Freiheit besass, muss der Abstand zu bestehenden Designs umso grösser sein. Bei den Formmarken gilt dagegen in der EU die sog. Abstandstheorie, d.h. es wird geprüft, welche Formen bereits auf dem Markt vorhanden sind. Je grösser der Abstand von diesen Formen ist, desto grösser ist der Schutzumfang der Formmarke. Zuletzt wurde erörtert, dass sich auch in der EU betreffend Positionsmarken offene Fragen ergeben. So stelle sich die Frage, ob bei Positionsmarken nicht die Gefahr des Ideenschutzes bestehe, falls die Kennzeichnungskraft der Positionsmarke nicht abstrakt geprüft werde.
Dr. Roger Staub und Dr. Verena von Bomhard erörterten im Stile eines «Ping-Pong-Spieles» die aktuelle Rechtsprechung zum Design- und Markenrecht in der Schweiz und in der EU. Humorvoll hielt Dr. Roger Staub fest, dass für die Schweiz aufgrund der nicht allzu zahlreichen Gerichtspraxis alle Entscheide seit dem Inkrafttreten des Designgesetzes unter aktuelle Rechtsprechung fallen würden.
Zum Thema «Rechtserlangung» vertrat Dr. Verena von Bomhard die Auffassung, dass ein «gutes Design» im Markenrecht nichts helfe, sondern evtl. sogar schädlich sei (Stichwort: Wesen der Ware, ästhetische Funktionalität). Dies würde u.a. der Entscheid des EuG in Sachen Lautsprecher (von B&O; EuG vom 6. Oktober 2011) zeigen. Erschwerend komme hinzu, dass bei Vorliegen der ästhetischen Funktionalität die Verkehrsdurchsetzung nicht zu einer Eintragung verhelfe (siehe EuGH vom 20. September 2007, «Benetton v. G Star»). Nach Auffassung der Referentin sollte der Schutzausschlussgrund der ästhetischen Funktionalität ersatzlos gestrichen werden.
Aus schweizerischer Sicht lassen sich bei der Frage der Rechtserlangung von Formmarken hinsichtlich der ästhetischen Funktionalität kleinere Unterschiede zur EU erkennen. So ergibt sich nach Dr. Roger Staub aus dem Panton-Stuhl-Fall (BGE 134 III 547), dass die Schweiz für Formmarken keinen expliziten Ausschlussgrund der ästhetischen Funktionalität kenne. Die ästhetische Funktionalität könne jedoch, wenn sie das Wesen der Ware ausmache, unter Art. 2 lit. a MSchG fallen. Zur Rechtserlangung muss sich die Form wesentlich von bestehenden Formen unterscheiden (3-D-Wellenverpackung, BGE 137 III 403). Ein Überblick über die Rechtsprechung führe nur einen neueren Entscheid zu Tage, bei dem das Kriterium «Wesen der Ware» massgebend war (3-D-Lindor-Kugel, BGer 4A.129/2007). Im Fall «Knetfamilie» (BVGer B-3273/2007) wurden 3-D-Knetfiguren als Bildmarken angemeldet und eingetragen, obwohl die Knetfiguren nicht unerwartet oder ungewöhnlich waren.
Zur Frage der technischen Funktionalität in der schweizerischen Rechtsprechung zeigte Dr. Roger Staub anhand des Lego-Falles (BGE 129 III 514 sowie BGer 4A.20/2012), dass die Abgrenzung zwischen technischer Notwendigkeit (Art. 2 lit. b MSchG) und technischer Bedingtheit (Art. 2 lit. a MSchG) unklar sei. Unklar bleibe auch weiterhin, ob die technische Funktionalität im Designrecht anders zu beurteilen ist als im Markenrecht. Gemäss BGer hat die Beurteilung gleich zu erfolgen (BGE 133 III 189, «Schmuckschatulle»). Der Referent ist allerdings diesbezüglich skeptisch. Die Ausgangslage im Designrecht sei unterschiedlich, weil im Gegensatz zum Markenrecht kein ewiger Schutz möglich sei. Daher sei auch die Gefahr, dass das Patentrecht durch eine Designeintragung unterlaufen werde, geringer.
In der EU wurde die technische Funktionalität in jüngster Zeit vor allem im Zusammenhang mit Komponenten oder komplementären Gegenständen diskutiert. Es wird dabei auf das Kriterium des «must match» abgestellt. Ist bei Komponenten die Form durch den Hauptgegenstand vorgegeben (d.h. «must match»), ist eine Eintragung ausgeschlossen.
Die Diskussion zum Thema «Rechtsdurchsetzung» wurde unterteilt in Rechtdurchsetzung i) Design-Design, ii) Marke-Design sowie iii) Design-Marke.
Bei einem Konflikt zwischen zwei Designs ist die Bestimmung des Schutzumfangs von besonderer Bedeutung. Nach Praxis des BGH (BGH vom 19. Mai 2010, «Untersetzer-Fall») ist bei dieser Frage nicht der Abstand zu bestehenden Designs entscheidend, sondern die Gestaltungsfreiheit und Musterdichte. Gemäss Dr. Verena von Bomhard dürften sich allerdings im Ergebnis zwischen den beiden möglichen Bestimmungen des Schutzumfanges kaum grosse Unterschiede ergeben. Mit Blick auf die Rechtsprechung des EuGH stört sich die Referentin daran, dass dieser bei Verletzungsprozessen nicht einen synoptischen Vergleich zwischen den beiden Designs durchführe, sondern auf das verschwommene Erinnerungsvermögen des Abnehmers abstelle.
In der Schweiz besteht gemäss Dr. Roger Staub in der Rechtsprechung Einigkeit, dass bei der Beurteilung eines Konfliktes nicht mehr der synoptische Vergleich, sondern das kurzfristige Erinnerungsbild des am Kauf interessierten Verbrauchers massgebend ist (siehe z.B. BGE 129 III 545, «Knoblauchpresse»). Allerdings ergeben sich immer noch Schwierigkeiten bei der Bestimmung dieses kurzfristigen Erinnerungsbildes. Der Referent kritisiert, dass gemäss BGer der Abnehmer nur die für ihn subjektiv wesentlichen Elemente im kurzfristigen Erinnerungsbild behalten solle. Zudem weist er darauf hin, dass das BGer bei einzelnen Erwägungen markenrechtliche Überlegungen einfliessen lasse, die für das Designrecht nicht relevant seien (so hielt z.B. das BGer im Fall «Herzchenanhänger» fest, dass die beiden Designs so aussehen würden, als gehörten sie zur selben Kollektion).
Im Zusammenhang mit dem Schutzumfang eines Designs befasste sich die Rechtsprechung in der Schweiz auch mit der Frage des Spezialitätsprinzips. In BGer 4A_288/2007 («Bague») führte das BGer aus, im Designrecht bestünde kein Spezialitätsprinzip. Der Referent ist allerdings unsicher, ob diese Aussage auch gemacht würde, wenn die sich gegenüberstehenden Produkte weiter voneinander entfernt sind als im vorliegenden Fall, wo es um Schmuck ging.
Dr. Roger Staub führte anhand von einzelnen Beispielen auch aus, dass seiner Meinung nach der Schutz eines Designs durch eine Formmarke Lücken aufweist. So wurde im Fall «Maltesers» (BGE 135 III 446) eine Verwechslungsgefahr trotz ähnlicher Ausstattung verneint, weil die auf den Verpackungen angebrachten Schriftzüge eine solche ausschliessen würden.
Betreffend Konflikte zwischen Marken und Designs führte Dr. Verena von Bomhard zum EU-Recht aus, dass die Marke wohl über einen höheren Schutzumfang verfüge als das Design. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr sei eher erfüllt als die Annahme einer Übereinstimmung im verschwommenen Erinnerungsbild des Abnehmers.
Zuletzt befasste sich Dr. Verena von Bomhard noch mit den Schranken des Designrechts. Zunächst hielt sie fest, dass ein eingetragenes eigenes Design einem Rechtsverletzer nichts nütze. Der EuGH musste diese Frage in mehreren Fällen entscheiden, weil insbesondere in Spanien die Gerichte entschieden hatten, dass ein eingetragenes Design in jedem Fall benutzt werden dürfe. Die Frage, ob markenrechtliche Schrankenregelungen auf das Designrecht übertragen werden müssen oder können, wurde dagegen vom BGH offengelassen (BGH vom 7. April 2011, «ICE»).
Malena Frau (Néstle S.A.), Stephan Engels (Siemens AG) sowie Dr. Peter Schramm (Vitra) ermöglichten den Teilnehmern einen spannenden und wertvollen Einblick in die Design- und Markenstrategien ihrer Unternehmen.
Malena Frau erklärte, Nestlés Markenstrategie konzentriere sich vorwiegend auf rund 29 besonders starke Marken. Diese starken «Hauptmarken» werden entsprechend in verschiedenen Ländern registriert und auch durchgesetzt. «Untermarken» (z.B. die Namen der verschiedenen Kapseln bei Nespresso) werden nicht in jedem Fall registriert. Nestlé meldet sehr viele Marken an (253 in 2011), aber auch immer mehr Designs (111 in 2011). Die Anzahl der Marken- und Designanmeldungen ist immer auch davon abhängig, ob z. B. gerade neue Produkte lanciert werden. Strategie von Nestlé ist es, Produkte rundum durch Kombination zwischen Marken- und Designanmeldungen zu schützen. Priorität hat dabei das Markenrecht, doch werden z.B. vor allem Verpackungen als Design geschützt. Aufgrund ihrer Erfahrungen geht Malena Frau davon aus, dass es sich bei den meisten Konflikten um Markenkonflikte handelt. Interne Studien hätten aber ergeben, dass das Designrecht einen besseren Schutz biete als das UWG. Dies habe z.B. damit zu tun, dass in China das UWG schwach ausgebildet sei, weshalb dieses im Gegensatz zum Designschutz gegen Fälschungen kaum helfe.
Dr. Stephan Engels zeigte auf, dass im Moment Siemens AG vielmehr eingetragene Marken als Designs besitzt. Er hielt hierzu aber auch fest, dass immer im Auge behalten werden müsse, dass Schutzrechte Geld kosten. Siemens AG habe vor allem Konflikte in Asien, da dort sowohl Marken als auch Designs immer wieder kopiert würden. Gemäss seiner Erfahrung sei bei solchen Konflikten der Schutz durch Marken stärker. Allerdings gebe es verschiedene Zolllager, die es faktisch erlauben würden, die kopierten Produkte erst nach der Verzollung mit Marken zu versehen. In diesen Konstellationen biete das Designrecht einen stärkeren Schutz vor Fälschungen. Gefahren sieht er darin, dass bekannte ausländische Designs in China von Konkurrenten registriert würden, um den Markteintritt des Original-Herstellers zu blockieren. Immerhin habe China diesbezüglich auf Kritik hin reagiert und die Schutzvoraussetzungen im Designrecht erhöht. Dr. Stephan Engels ist der Meinung, dass das Designrecht bis anhin zu Unrecht als «Trostpreis» betrachtet wurde. Geschützte Designs stellen seiner Meinung nach einen Wettbewerbsvorteil dar und seien auch für die Vermarktung wichtig. Zudem hätten Designs wegen der Vermutung der Rechtsbeständigkeit eine nicht zu unterschätzende Durchschlagskraft, insbesondere in vorsorglichen Massnahmeverfahren. Kritisch steht er dem Eintragungsverfahren gegenüber, welches evtl. zu einfach sei (und zwar eben auch für die Konkurrenz, was gewisse Risiken mit sich bringe). Weil der Schutzumfang des Designs entscheidend sei, ist die Marktrecherche vor der Anmeldung wichtig. Die Ergebnisse der Recherche hinsichtlich bestehenden Formenschatzes müsse daher genau dokumentiert werden. Zuletzt macht der Referent noch auf Gefahren bei der Auslagerung von Designleistungen aufmerksam. Da nicht in allen Fällen eine automatische Rechtsübertragung auf den Arbeitgeber oder Auftraggeber erfolge, müsse dies vertraglich geregelt werden. Dasselbe gelte auch, wenn solche Leistungen in Länder ausgelagert werden, in denen Designs als Patente angemeldet werden. Es müsse in diesen Fällen genau geregelt werden, wer bei der Anmeldung als Erfinder und wer als Patentinhaber genannt werde.
Im Falle von Vitra (Möbelindustrie) erläuterte Dr. Peter Schramm, dass Designs häufig kopiert, aber nicht mit verwechselbaren oder identischen Marken versehen würden. Dies mache die Bekämpfung der Fälschungen schwieriger, führe aber auch dazu, dass für die Vitra Designrechte sehr wichtig seien. Neue Produkte würden daher regelmässig als Design angemeldet, während man ältere nicht als Design registrierte Klassiker über das Urheberrecht oder als Formmarke zu schützen versucht. Zuletzt führe auch das UWG zu einem zusätzlichen Schutz. Die Schutzstrategien seien vor allem davon abhängig, wie die Rechtsgrundlagen in den betreffenden Zielmärkten ausgestaltet seien. Ziel sei immer ein kumulativer Designschutz. So würde z. B. je nach Markenrecht und Rechtsprechung bei neuen Produkten die Unterscheidungskraft noch fehlen und die Eintragung als Formmarke damit scheitern. In diesen Fällen werden die Produktdesigns als Designrecht angemeldet. Gemäss Einschätzung von Dr. Peter Schramm kämen typische Markenrechtsverletzungen (d.h. das Anbringen der Marke «Vitra» auf Kopien) selten vor, während Fälle von Formmarkenverletzungen zahlreicher sind. Das Unternehmen müsse regelmässig Fälschungen an Möbel- bzw. Designmessen beschlagnahmen und zerstören lassen. Als Fazit geht Dr. Peter Schramm davon aus, dass das Designrecht aufgeholt, nicht aber das Markenrecht überholt habe. Das Designrecht werde nunmehr als eigenständiges Immaterialgüterrecht wahrgenommen.
Dr. Pascal Fehlbaum führte mit metajuristischen Überlegungen in die Thematik ein. Insbesondere zeigte er auf, dass der moderne Designer eine schwierige Aufgabe habe. Der Designer müsse technische, ökonomische und ästhetische Aspekte im Design integrieren.
Des Weiteren zeigte er auf, inwiefern sich die verschiedenen Immaterialgüterrechte von ihrem Schutzziel her unterscheiden, was wiederum zur Frage führte, ob die einzelnen Rechte einen kumulativen oder exklusiven Schutz zur Folge haben.
Im Verhältnis zwischen Urheberrecht und Patentrecht sei ein kumulativer Schutz möglich, sofern die Schöpfung nicht eine rein technische Lösung ohne ästhetischen Aspekt darstelle.
Im Verhältnis zwischen Design und Urheberrecht zeige sich, dass in der Schweiz ein teilweiser kumulativer Schutz möglich sei. Entscheidend ist dabei die Höhe der Originalität. Ist diese hoch, ist ein Schutz als Urheberrecht auch bei Designs möglich (siehe z. B. die Ausführungen des BGer in BGE 134 III 549, «Panton-Stuhl»). Ob der individuelle Charakter für das Urheberrecht graduell höher ist als die Eigenart für das Design, ist aus praktischer Sicht aber schwierig festzustellen.
Im Verhältnis zwischen Patentrecht und Designrecht ist entscheidend, ob die Schöpfung (auch) einen ästhetischen Zweck hat, ansonsten kein Designrecht möglich ist. Andererseits darf ein Design nicht technisch bedingt sein, da sonst das Patentrecht unterlaufen würde.
Zwischen Markenrecht und Designrecht ergeben sich Gemeinsamkeiten zwischen Formmarken und Designs. Allerdings ist der Schutzbereich doch unterschiedlich. So wird die «Originalität» bei Formmarken anders bestimmt als bei Designs (die Formmarke muss z.B. nicht neu sein). Gemeinsamkeiten ergeben sich dagegen in der Rechtsprechung betreffend die Frage der technischen Funktionalität.
Im Verhältnis zwischen UWG und Designrecht wird immer noch häufig die sog. Umwegthese vertreten. Ein kumulativer Schutz sei daher nur möglich, wenn zur Designrechtsverletzung noch zusätzliche Unlauterkeitstatbestände hinzukommen. Er verwies noch explizit darauf hin, dass Art. 2 UWG das systematische Kopieren als eigenständigen Unlauterkeitstatbestand betrachtet.
Zuletzt stellte Dr. Pascal Fehlbaum zur Diskussion, ob die Bestimmung der Eigenart eines Designs in der schweizerischen Praxis korrekt erfolge. In der Schweiz werde bei der Bestimmung der Eigenart häufig der sog. trademark approach (Vergleich mit dem bestehenden Stand des Designs) angewandt. Er würde dagegen einen sog. copyright approach bevorzugen, weil es beim Designrecht im Gegensatz zum Markenrecht um den Schutz der Innovation und damit in wirtschaftlicher Hinsicht wie beim Urheberrecht um die Belohnung der Innovationsleistung ginge. Betreffend die in anderem Zusammenhang von Dr. Michael Ritscher aufgeworfene Frage, ob das Wort «Midas» in Arial-Schrift als Design geschützt werden könne, vertrat er die Auffassung, dass der Wortsinn nicht geschützt wäre. Designschutz könnten nur die Linien und Konturen erlangen, sofern sie neu und eigenartig seien.
Dr. Henning Hartwig fasste im Sinne eines einleitenden Überblicks die verschiedenen Immaterialgüterrechte (Designschutz, Markenschutz, Urheberschutz) in der EU und der Schweiz zusammen und erinnerte hierbei insbesondere auch daran, dass es im Gegensatz zur Schweiz in der EU (und in UK) auch nicht eingetragene Designrechte sowie in Deutschland nicht eingetragene Markenrechte gebe.
Mit Bezug auf das vorangegangene Referat von Dr. Pascal Fehlbaum hielt er fest, dass im Designrecht in der EU betreffend die Bestimmung der Eigenart eher ein patent approach bzw. ein copyright approach, nicht jedoch ein trademark approach vorherrschend sei.
Hinsichtlich Lauterkeitsrecht machte er darauf aufmerksam, dass dieses Rechtsgebiet in der EU nicht vollständig harmonisiert wurde, auch wenn die UGP-Richtlinie (2005/29/EG) besteht, die in Anhang I Geschäftspraktiken aufführt, die unter allen Umständen als unlauter gelten. Die UGP-Richtlinie sieht in Anhang I Nr. 13 u.a. vor, dass Werbung, die geeignet ist, beim Verbraucher eine Herkunftstäuschung hervorzurufen, unlauter ist. Trotz der unterschiedlichen Formulierung dürfte dieser Tatbestand mit der lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsgefahr nach Art. 3 lit. d UWG vergleichbar sein, auch wenn sich in der richterlichen Praxis Unterschiede ergeben.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen zeigte Dr. Henning Hartwig anhand von Gerichtsurteilen Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Lauterkeitsrecht in der Schweiz und in der EU auf. Sowohl in der EU als auch in der Schweiz ist die technische Funktionalität auch im Lauterkeitsrecht eine relevante Thematik. Es soll vermieden werden, dass Formen oder Ausstattungen über das Lauterkeitsrecht geschützt werden können, obwohl ein Schutz durch Immaterialgüterrechte nicht möglich ist. Gemäss Rechtsprechung des HGer Aargau könne es für das UWG dabei keine Rolle spielen, dass eine andere Gestaltung möglich oder zumutbar sei. Anders entschied dagegen der deutsche BGH im Fall «Ausbeinmesser» (Urteil vom 2. April 2009), in welchem der BGH festhielt, dass der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz bei Gestaltungsmerkmalen, die zwar technisch bedingt, gleichwohl aber frei austauschbar seien, nicht ausgeschlossen sei. Der Leistungsschutz ist damit in Deutschland vielmehr nur dann absolut ausgeschlossen, wenn es sich um eine technisch zwingend notwendige Gestaltung handelt.
Weiter zeigte der Referent auf, dass gemäss Praxis in der EU das Anbringen einer unterschiedlichen Marke auf dem nachgeahmten Produkt eine Verwechslungsgefahr in der Regel ausschliesse oder zumindest reduziere. Sofern das nachgeahmte Produkt allerdings praktisch identisch mit dem Original ist, dürfte dagegen wieder eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr vorliegen, weil der Verbraucher evtl. davon ausgeht, dass zwischen dem Hersteller des Originalproduktes und demjenigen der Kopie eine vertragliche Verbindung besteht (z. B. ein Lizenzvertrag).
Skeptisch äusserte er sich zu einem Entscheid des OLG Köln vom 12. September 2008 («Kunststofftasche»), in dem das Gericht die Nominierung für einen Designpreis als Indiz für die wettbewerbliche Eigenart und damit die Kennzeichnungsfähigkeit berücksichtigte. Es sei fraglich, ob wettbewerbliche Eigenart identisch mit der Kennzeichnungsfähigkeit sei.
Zuletzt zeigte der Referent anhand der sog. «Crocs»-Fälle, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Urteilen führten, wie es trotz relativ vergleichbarer lauterkeitsrechtlicher Regelungen zu unterschiedlichen Urteilen kommen kann. In der Schweiz wurde eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr sowohl vom Handelsgericht Aargau (Urteil vom 9. September 2008) als auch vom Kreisgericht Bern-Laupen (Urteil vom 12. November 2008), allerdings mit unterschiedlicher Begründung, abgelehnt. Das HGer Aargau erachtete die Gestaltung der «Crocs»-Schuhe nicht als originär kennzeichnungskräftig und verneinte auch eine Verkehrsdurchsetzung, da die Schuhe im damaligen Zeitpunkt erst seit zwei Jahren auf dem Markt waren. Das Gericht liess zudem offen, ob die Verwechslungsgefahr durch das Anbringen einer zusätzlichen Etikettierung durch den Nachahmer nicht ohnehin auszuschliessen wäre. Das Kreisgericht Bern-Laupen verneinte eine unlautere Nachahmung mit Berufung auf die technische bzw. ästhetische Funktionalität der Produktgestaltung. Zudem bestünden die Schuhe aus einfachen geometrischen Formen, weshalb eine originäre Kennzeichnungskraft ausgeschlossen wurde. Eine Verkehrsdurchsetzung wurde ebenfalls verneint. Das HGer Wien (Beschluss vom 19. Februar 2008) verneinte wiederum einen lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch, weil der Nachahmer durch das Anbringen seiner eigenen Markenbezeichnung auf dem Schuh die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen habe. Das OLG Düsseldorf (Urteil vom 8. Juli 2008) bejahte dagegen eine wettbewerbsrechtliche Eigenart der «Crocs»-Schuhe, da diese im Laufe der Zeit Kultcharakter entwickelt hätten.
Dr. Henning Hartwig nahm darüber hinaus auch noch zum «Apple»-Urteil des OLG Düsseldorf Stellung. Das Gericht verneinte zwar eine Herkunftstäuschung, bejahte dagegen aber eine Rufausbeutung. Bei der Rufausbeutung gehe es laut OLG Düsseldorf darum, dass das Nachahmerprodukt dessen Käufern erlaube, vom «Angebereffekt» des Originalproduktes zu profitieren. Der Referent stellte hierbei die Frage, wie bei der Rufausbeutung der massgebliche Verbraucherkreis zu bestimmen sei. Er stellte die These auf, dass als massgeblicher Verbraucherkreis Personen angenommen werden müssten, die keine potenziellen Käufer des Original- wie auch des Nachahmerproduktes seien. Nur bei diesem Personenkreis könne überprüft werden, ob das Nachahmerprodukt denselben Angebereffekt wie das Originalprodukt erzielen könne.
Dr. Michael Ritscher ergänzte, dass auch in der schweizerischen Praxis die unnötige Anlehnung oder Rufausbeutung nach Art. 3 lit. e UWG bei Produktnachahmungen immer mehr zur Anwendung gelange.
Der zweite Tag des Ittinger Workshops stand im Zeichen von Gruppendiskussionen zu relevanten designrechtlichen Themen.
Eine erste Gruppe unter der Leitung von Stefan Fraefel setzte sich mit der Frage der Schutzvoraussetzungen von Designs auseinander. Wie von Dr. Michael Ritscher vorgegeben, diskutierte die Gruppe u.a. die Frage, ob das Wort «Midas» in Arial-Schrift als Design eingetragen werden könne. Die Gruppe kam zum Schluss, dass – Neuheit und Eigenart vorausgesetzt – ein solches Design sowohl in der Schweiz als auch der EU eingetragen werden könne. Farben alleine im Sinne einer abstrakten Farbmarke könnten dagegen nicht als Design eingetragen werden, da es an der Bestimmbarkeit des Schutzobjektes fehlen würde. Die Gruppe stellte sich zudem die Frage, ob im Designrecht Bedarf für ein sog. umgekehrtes Widerspruchsverfahren bestünde. Ein solches (vor- oder nachgelagertes) Verfahren könnte allenfalls die Rechtssicherheit beim Anmelder (betreffend Rechtsbeständigkeit), aber auch bei Dritten erhöhen. Allerdings wäre eine solche Vorprüfung im Designrecht wegen des fehlenden Spezialitätsprinzips schwierig durchführbar und es scheine auch kein Bedarf daran zu bestehen. Betreffend die technische Funktionalität, bei deren Bestimmung in der Schweiz kein Unterschied zwischen Design- und Markenrecht besteht, war die Gruppe der Auffassung, dass dies nicht korrekt sei. Im Designrecht solle nur dann von einer technischen Funktionalität ausgegangen werden, wenn das Design die einzige mögliche Variante sei. Dies bedeutet, dass bei Vorliegen von Alternativen der Schutz im Gegensatz zur EU nicht ausgeschlossen sein soll. Begründet wird dies mit der unterschiedlichen Schutzdauer des Designs bzw. der Marke. Betreffend ästhetische Funktionalität war die Gruppe der Meinung, das Kriterium könnte ersatzlos gestrichen werden, da die bisherigen Definitionsversuche des BGer unpraktikabel seien und auch in der EU keine Rechtssicherheit bestünde. Eine entsprechende Form sei wohl ohnehin nicht kennzeichnungskräftig.
Die zweite Gruppe unter der Leitung von Dr. Verena von Bomhard befasste sich mit dem Schutzumfang im Design- und Markenrecht. Die Gruppe kam zum Schluss, bei der Frage, ob das Design- oder Markenrecht diesbezüglich besser sei, käme es auf die entsprechende Parteirollenverteilung an. Für den Kläger in einem Designrechtsverletzungsprozess ergäbe sich evtl. eine bessere Ausgangslage, da der Beklagte beweisen müsse, dass das Produkt nicht eigenartig sei. Durch diese Beweisführung werde gleichzeitig auch der Schutzumfang mitbestimmt. Im Markenrecht müsse dagegen der Kläger in jedem Fall den Schutzumfang seiner Marke beweisen. Im Hinblick auf die Eintragungsfähigkeit des Wortes «Midas» kam die Gruppe zum Schluss, dass dieses ohne zusätzliche schöpferische Gestaltung (z.B. im Schriftbild) nicht eigenartig sei. Falls es dennoch eingetragen würde, wäre der Schutzumfang sehr gering und gerade mal auf identische Designs beschränkt. Die Gruppe kam zum Schluss, dass bei 3-D-Formen und bei reinen Bildern der Schutzbereich im Designrecht wohl grösser sei als beim Markenrecht. Zudem würde in diesen Fällen die Form bzw. das Bild leichter als Design eingetragen, während zumindest in der EU die Praxis zur Eintragung von Formmarken sehr restriktiv ist. Zuletzt diskutierte die Gruppe die Frage, ob tatsächlich im Designrecht das Spezialitätsprinzip nicht anwendbar sei. Betreffend die Frage der Neuheit eines Designs würde je nach Produkt teilweise auf die Kenntnisse von Fachkreisen abgestellt. Dies könnte dazu führen, dass, weil für ein anderes Produkt andere Fachkreise massgeblich seien, auch ein jüngeres Design als neu gelten könnte. Es stellte sich daher die Frage, ob es hier zu Konfliktsituationen kommen könne.
Die dritte Gruppe befasste sich unter der Leitung von Dr. Henning Hartwig mit der Frage der relevanten Betrachtungsweise bei der Bestimmung der Neuheit und Eigenart, wobei hier das (fehlende) Spezialitätsprinzip und die sich daraus ergebenden Auswirkungen ein wichtiges Thema darstellten. Damit sowohl die Bestimmung der Eigenart und Neuheit als auch die Bestimmung des Schutzumfanges produktunabhängig ausfalle, müsse bei der Betrachtungsweise eigentlich auch auf einen produktunabhängigen Verbraucherkreis abgestellt werden. Allerdings sei diesbezüglich unklar und es ergäben sich auch keine Hinweise aus der Rechtsprechung hierzu, wie dieser Verbraucherkreis genau zu bestimmen wäre. Ist z. B. auf Fachpersonen als relevanter Verbraucherkreis abzustellen, stelle sich die Frage, wie spezialisiert diese Fachpersonen sein dürfen (z.B. Marketing-Professor oder Spezialist für Konsumgütermarketing). Als weiteres Thema befasste sich diese Gruppe mit der Zulässigkeit und Nützlichkeit von Umfragen. Da in der Schweiz die Verwechslungsgefahr eine Rechtsfrage sei, könne die Verwechslungsgefahr nicht mit Umfragen bewiesen werden. Beim Designrecht könne für den Vergleich der Gemeinsamkeiten zwischen Originaldesign und Verletzungsgegenstand dagegen wohl auf Umfragen abgestellt werden. Allerdings seien die Fragestellungen richtig auszugestalten. Beim Designrecht sei z.B. nicht danach zu fragen, ob die Befragten die Produkte verwechseln würden. Mit Blick auf das Lauterkeitsrecht stellte die Gruppe die Frage, ob dort Umfragen hilfreich sein könnten. Weil z.B. das Anbringen einer eigenen Marke auf ein Nachahmungsprodukt die lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr bereits ausschliessen könne, entstehe eine Schutzlücke. Umfragen könnten allenfalls zeigen, dass trotz fremder Marke eine Verwechslungsgefahr bestünde. Bei der Frage der Rufausbeutung war die Gruppe der Meinung, dass Umfragen allenfalls helfen könnten. Allerdings müssten mit Blick auf die Definition der Rufausbeutung («Angebereffekt») wohl Personen befragt werden, die nicht zu den potenziellen Käufern der streitigen Produkte gehören.
Die vierte Gruppe unter der Leitung von Dr. Robert Stutz setzte sich mit dem Thema «Inhaberschaft und Verwertung» auseinander. Bei einer komplexeren Designentwicklung stelle sich häufig die Frage, wer Inhaber des Designs sei. Die Gruppe schlug vor, dass die Inhaberschaft anhand des Verantwortungsgebietes der involvierten Personen zu bestimmen sei. Wird z.B. eine Person mit der Kreation eines Designs beauftragt, ist diese für die Designschöpfung verantwortlich und damit Inhaber. Im Arbeitsverhältnis ist regel|mässig der Arbeitnehmer der Schöpfer, Inhaber jedoch der Arbeitgeber. Dies kann zu Konflikten führen, wenn dasselbe Design auch als Urheberrecht geschützt ist. Beim Urheberrecht erfolgt keine automatische Rechtsübertragung auf den Arbeitgeber. Es könnte daher vorkommen, dass die Rechte am selben Design einerseits beim Arbeitnehmer liegen (Urheberrecht), andererseits beim Arbeitgeber (Designrecht), falls die Rechtsübertragung nicht vertraglich geregelt wurde. Fraglich sei dann, ob der Arbeitnehmer die Designs gestützt auf sein Urheberrecht z. B. in einer Bewerbungsmappe zeigen darf, oder ob der Arbeitgeber dies aus seinem Designrecht verbieten kann. Die Gruppe ist der Meinung, dass eher kein Unterlassungsanspruch seitens des Arbeitgebers bestünde.
Dr. Eric Meier erachtete die Entwicklung des Designrechts 10 Jahre nach Einführung des Designgesetzes als positiv. Der Designschutz sei für die Industrie in ihrer Schutzstrategie immer wichtiger. Der Markenschutz sei nicht generell besser als der Designschutz. Es hänge vielmehr von der Situation und der Schutzstrategie ab. Beide Schutzsysteme verfolgten verschiedene Ziele, was die Unterschiede bezüglich Schutzvoraussetzungen, Schutzumfang und Schutzdauer rechtfertige. Aufgrund der restriktiven Praxis der Ämter sei das Designrecht im Bereich von Waren- und Verpackungsformen eine wertvolle Alternative zum Markenschutz, in anderen Bereichen eine sinnvolle Ergänzung (z.B. Schutz von Logos). Er stellte fest, dass es viel Rechtsprechung im Markenrecht gäbe und somit die Rechtssicherheit höher als im Designrecht sei, wo weniger Urteile vorlägen. In Bezug auf den Vorschlag einer Gruppe, bei der Beurteilung der technischen Funktionalität aufgrund der unterschiedlichen Schutzdauer einen Unterschied zwischen Marken- und Designrecht zu machen, stellte er die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Berücksichtigung von Alternativen in den beiden Rechtsgebieten hätte. Zudem stellte er einen Bedarf nach einer besseren Recherchierbarkeit von geschützten Designs fest, was jedoch wohl nicht einfach zu bewerkstelligen sein werde. Anhand der geringen Anzahl von jährlichen Verfahren vor dem HAMB scheine ein Bedarf nach einem administrativen Löschungsverfahren im Designbereich nicht zu bestehen. Schliesslich stellte er fest, dass sich aus den vorangehenden Diskussionen Unklarheiten betreffend die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise beim Designgesetz ergeben hätten.
Auch Dr. Michael Ritscher hält in seinem Fazit fest, es handle sich beim Designschutz um eine starke Waffe. Er stellte fest, dass fast alle markenrechtlich schützbaren Zeichen auch durch das Designrecht geschützt werden können und dass ein Schutz durch Designrecht wesentliche Vorteile gegenüber einem Markenschutz aufweise. So bestünde eine Vermutung der Rechtsbeständigkeit, sei der Schutz produktunabhängig, bestünde keine Gebrauchspflicht, würden technische Funktionen weitergehend umfasst und decke eine Schutzdauer von 25 Jahren auch die Lebensdauer der meisten Produkte ab. Zudem bestehe in der EU ein formfreier Schutz während dreier Jahren. Problematisch erachtet er die schlechten Recherchiermöglichkeiten beim Designrecht, da der Kläger in einem Designrechtsverletzungsprozess im Vorfeld die Rechtsbeständigkeit selber abklären müsse, auch wenn ihn keine Beweislast treffe, und der Beklagte sich kaum, geschweige denn schnell, mit älterem Formenschatz verteidigen kann. Dass das Designrecht noch nicht ganz auf der Überholspur ist, sieht er darin begründet, dass es wohl einfach noch zu wenig bekannt sei. Daher würden die Unternehmen häufig zuerst auch nicht an den Designschutz denken und wenn sich die Frage stelle, sei evtl. die Neuheit bereits durch die eigenen Vertriebsaktivitäten zerstört. Darüber hinaus sei das Designrecht als Schwachpunkt wenig internationalisiert, was es für international tätige Unternehmen weniger attraktiv mache. Ausserhalb von Europa gebe es häufig keinen Designschutz.
Betreffend Spezialitätsprinzip findet sich gemäss Dr. Michael Ritscher keine Stütze für oder wider das Spezialitätsprinzip in den Gesetzen, doch entspreche es einhelliger Meinung, dass das Spezialitätsprinzip sowohl bei der Neuheitsprüfung als auch beim Schutzumfang nicht zur Anwendung gelange. Allerdings müsse aufgrund des fehlenden Spezialitätsprinzips, wie dies bereits von Dr. Henning Hartwig ausgeführt worden sei, der massgebliche Abnehmerkreis ebenfalls produktunabhängig festgelegt werden, was offene Fragen zur Folge habe.
Sowohl Dr. Robert Stutz als auch Bernhard Volken verwiesen darauf, dass die Locarno-Klassifikation im Designrecht rein administrativen Charakter besitze, woraus sie das fehlende Spezialitätsprinzip ableiten. Zudem verwies Dr. Robert Stutz darauf, dass der Zweck des Designrechts im Schutz von Innovationen liege. Sofern ein Design bestehe, handle es sich seiner Meinung nach nicht mehr um eine Innovation, wenn man dieses bestehende Design einfach auf ein neues Produkt übertrage.
Dr. Christoph Gasser übernahm die Aufgabe, auf die abweichenden Lehrmeinungen (insbesondere Markus Wang und Peter Heinrich) zu verweisen, die von der Anwendung des Spezialitätsprinzips auch im Designrecht ausgehen. Das BGer hat die Frage nicht abschliessend geklärt.
Einig war man sich, dass bei einem Fehlen des Spezialitätsprinzips eine verbesserte Recherchierbarkeit von bestehenden eingetragenen Designs wichtig wäre. Gemäss Dr. Robert Stutz sind in dieser Hinsicht Bestrebungen im Gange. Das Locarno-System soll dabei von einer produktunabhängigen Kategorisierung (z.B. geometrische Einzelmerkmale eines Designs) überlagert werden. Es ist allerdings noch nicht absehbar, ob und bis wann das Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann.
Der Ittinger Workshop hat auch dieses Jahr zu fruchtbaren Diskussionen unter den Teilnehmern geführt und insbesondere aufgezeigt, wo im Designrecht offene Fragen bestehen, die von der Praxis und Literatur zu beantworten sind. Einigkeit besteht darin, dass zwar nicht von einer Überholspur gesprochen werden kann, dass aber der Designschutz immer wichtiger wird und gegenüber dem Markenschutz je nach Konstellation auch durchaus Vorteile aufweist.

